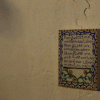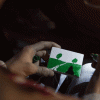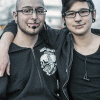Von Alexander Pfeiffer. Fotos: Arne Landwehr.
Als „Stadtflucht“ wird die Abwanderung der städtischen Bevölkerung ins Umland bezeichnet: Wer es sich leisten kann, zieht dahin, wo die Lebensqualität höher und das Wohnumfeld grüner ist. Doch wohin flieht, wer die Innenstadt und den Schutz ihrer Anonymität braucht, um existieren zu können? Welche Zufluchtsorte bietet Wiesbaden denjenigen, die nicht mehr Schritt halten können?
„Eigentlich wollte ich weiter nach Frankreich“, erzählt Christian. Die Kleidung des 47-Jährigen ist outdoor-tauglich, seine Habe transportiert im Rucksack. In seinem Ausweis steht statt einer Anschrift der Vermerk „keine Hauptwohnung in Deutschland“. Geboren in der bayerischen Oberpfalz, aufgewachsen in einem Heim bei Nürnberg, verschlug es ihn nach Straubing, Köln, Münster, Wiesbaden, Frankreich, Italien, Schwerte und zurück nach Münster. Immer wieder musste er fliehen: vor widrigen Umständen und falschen Freunden, manchmal auch der Justiz.
Letztes Glied der sozialen Kette
Wenn schon keinen festen Wohnsitz, so hat Christian doch eine Postadresse: Dotzheimer Straße 9 – die Teestube des Diakonischen Werks. Sie ist der „gewöhnliche Aufenthalt“ für alle, die hier zweimal pro Woche Post abholen. Eine Postadresse ist Voraussetzung für den Bezug von Sozialleistungen: 382 Euro stehen einer erwachsenen alleinstehenden Person im Monat zu. Ohne Postadresse gibt es lediglich den Tagessatz von 12,30 Euro. Die Auszahlung öffnet jeden Tag eine halbe Stunde, die Schlange ist lang. „Wir haben täglich 100 bis 120 Besucher“, sagt Matthias Röhrig. Den Kreis der Wohnungslosen oder „sozial Ausgegrenzten“ schätzt der Leiter der Teestube auf 450, dazu pro Jahr etwa 500 Durchreisende: „Der vermeintliche ‚Wandertrieb’ der sogenannten ‚Nichtsesshaften’ kommt daher, dass man weiter muss, um das Geld täglich in einer anderen Stadt abzuholen.“ Denn die 12,30 Euro gibt es pro Stadt und Person nur ein Mal im Monat – wer sie in Wiesbaden erhalten hat, darf für die nächsten 30 Tage hier nichts mehr bekommen. „Vertreibungspolitik“ nennt das Matthias Röhrig, bei dem die landen, „die durch sämtliche Hilfesysteme fallen. Die Teestube ist das letzte Glied der sozialen Kette.“
Wie brüchig die soziale Kette längst ist, hat das politische Gerangel um den Armutsbericht der Bundesregierung kürzlich verdeutlicht. Dass die Schere zwischen Arm und Reich sich weiter öffnet, dass dies „das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung“ verletzen und „den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden“ könne, wollte mancher Regierungsvertreter nicht schwarz auf weiß haben. Fakt ist, selbst in einer wohlhabenden Stadt wie Wiesbaden leben aktuell etwa 22% aller unter 15-Jährigen in einer Familie, die Sozialleistungen nach dem SGBII bezieht, wie das Pressereferat der Stadt bestätigt.
„Alle kommen unter“
Rolf Deinet ist als Leiter der Abteilung Sozialhilfe und Flüchtlingswesen beim Amt für Soziale Arbeit zuständig für das Thema Obdachlosigkeit. „Die Stadt steckt jährlich etwa 500.000 Euro in den Betrieb der beiden Wohnheime der Heilsarmee “, erklärt er. Mit der Notunterkunft „Biwak“ der Teestube bieten die Einrichtungen etwa 260 Schlafplätze, die Auslastung liegt, gerade im Winter, bei etwa 95%. „Alle, die in Wiesbaden Obdach suchen, kommen unter.“ Christa Enders ist Abteilungsleiterin des Sozialdienstes. Sie weiß, dass es Menschen gibt, „die Hilfsangebote nicht annehmen können, weil sie von ihrem Schicksal so beeinträchtigt sind, dass sie das nicht hinbekommen“. Daher fördere man niedrigschwellige Angebote, die keine großen bürokratischen oder emotionalen Hürden aufbauen.
Übernachtung auf „Schlafschein“
Niedrig ist auch die Schwelle, die in das Wohn- und Übernachtungsheim der Heilsarmee für Männer in der Schwarzenbergstraße führt. „Das ist wie ein kleiner Hotelbetrieb hier“, erzählt Leiter Hans-Jürgen Schürmann. Wer erstmals hier übernachtet, landet im Durchgangsbereich im Erdgeschoss. Hier stehen in den Zimmern bis zu 14 Betten, dazu Schränke mit Vorhängeschlössern. Wer eine Nacht bleibt, zahlt 2,50 Euro – wer dauerhaft bleibt, hat meist eine Kostenzusicherung vom Sozialamt. Mit diesem „Schlafschein“ plus polizeilicher Anmeldung kann man ins Wohnheim auf den oberen Stockwerken wechseln. Hier sind je zwei Männer in einem Zimmer. „Manche sind schon 30 Jahre und länger hier“, sagt Schürmann, der die Leitung des Heims 2002 von seiner Mutter Margarete übernommen hat. Einige der Langzeitbewohner gehören als Hausmeister oder Pförtner auch zum Personal. Für den 86-Jährigen Herrn Schmidt im ersten Stock hat man sogar einen Kühlschrank und ein Pflegebett angeschafft. „Ich hab mich nach einem Schlaganfall wieder aufgerappelt“, lächelt der Senior des Heims, „jetzt mach´ ich bestimmt noch 20 Jahre.“
Dass gerade junge Menschen auch emotionale Gründe zur Flucht treiben, weiß man in der Mädchenzuflucht INTAKT. Ariane (15) war zwar versorgt, kannte aber kein Familienleben. Ihr Vater reagierte auf Schwierigkeiten mit Gewalt. So landete sie in der Mädchenzuflucht, die seit 25 Jahren vom Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not e.V. betrieben wird – ebenso wie die Beratungsstelle ZORA für Mädchen und junge Frauen in der Adolfstraße. „Hier geht es darum, über ‚Beziehungsarbeit’ überhaupt in Kontakt zu kommen, um Hilfe wieder anzunehmen“, erklärt Susanne Nink vom Vereinsvorstand, und Kollegin Alice Mellentin ergänzt: „Das ist ein geschützter Bereich und es kann auf Wunsch jeder anonym bleiben.“ Zum Offenen Treff an vier Nachmittagen in der Woche kommen etwa 10 Mädchen zwischen 16 und 19 Jahren. Manche leben in der Familie, manche auf der Straße. In den gemütlichen Räumen können sie zur Ruhe kommen, duschen, kochen, sich um Bewerbungen oder eine Wohnung kümmern. „Manche gehen von hier direkt wieder zum Bahnhofsvorplatz oder in die Reisinger Anlagen“, weiß Alice Mellentin.
„Völkerwanderung“ am Hauptbahnhof
Eben dort, an den Reisinger Anlagen, steht der UPSTAIRS-Bus der Jugendhilfe von EVIM (Evangelischer Verein für Innere Mission in Nassau). „Upstairs“, weil er die erste Stufe auf der Treppe in eine neue Zukunft sein soll. „UPSTAIRS ist keine ‚verordnete Maßnahme’“, sagt Bereichsleiterin Simone Wittek. „Unsere Auftraggeber sind die Jugendlichen, die aus eigenem Antrieb herkommen.“ Gerade haben Claudia Grilletta und Jens Hock, die den Bus betreuen, einen jungen Mann zum Bahnhof gebracht: „Der war ein halbes Jahr auf der Flucht. Wir haben ihm Essen, Schuhe und eine Fahrkarte gekauft. Jetzt ist er auf dem Weg zu seiner Mutter.“ Seit fünf Jahren steht der Bus auf diesem Dauerparkplatz nahe des stadtbekannten Drogenumschlagplatzes. Sein Inneres ist ausgestattet mit Sitzgelegenheiten, Tischen und einer Küchenzeile. Die Wände zieren Tigerfellmuster und Regalborde mit Pflanzen, über der Spüle raucht Kurt Cobain. Draußen hängt die Notfallnummer, über die Grilletta oder Hock rund um die Uhr erreichbar sind. Die ansässige „Szene“ schätzt und respektiert den Bus, durch eine städtische Politik verschärfter Kontrollen und Platzverweise ist aber auch eine „Völkerwanderung“ seiner Klientel zu beobachten: „Wenn es hier zu ungemütlich wird, ziehen sie zum Bahnhof, ins Parkhaus vom Lilien-Carré oder zum Schlachthof“, hat Jens Hock beobachtet.
Freiraum Kulturpark
Seit 2009 der „Kulturpark“ rund um den Schlachthof eröffnet wurde, erfährt das Areal großen Zulauf. Das blieb laut Befragung des Amts für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik von 2012 nicht folgenlos: „Hoher Alkoholkonsum, Körperverletzungen, Diebstähle und Raubstraftaten nahmen zu.“ Dietmar Krah, der beim Amt für Soziale Arbeit das Projekt „Kultur im Park“ betreut, bestätigt die Anziehung des Geländes als Zufluchtsort: „Man wird hier nicht gleich weggeschickt.“ Er und seine Mitstreiter versuchen, für ein „angenehmes Miteinander “ zu sorgen. Zum Team gehört auch Boris Seel von der Kreativfabrik. „Früher war das hier ein sozikultureller Treffpunkt, der die Leute animierte, eigene Projekte an den Start zu bringen“, sagt er. „Viele die heute kommen, wollen sich nur noch entziehen.“ Ein Besuch am Abend zeigt, was er meint: Während die Sonne hinter den Bahngleisen untergeht, vertreibt sich eine Gruppe Jugendlicher die Zeit mit Flaschenbier und Musik aus dem Ghettoblaster. Punks, Skins, Metalfreaks und Gothics. Jojo (18) und Felix (28) haben von „Kultur im Park“ schon etwas mitbekommen: „Aber das ist mehr für Familien. Was wir brauchen, ist nur Feuerholz, Stühle und ein Grill.“ Die von „Kultur im Park“ gezimmerten Holzsitze sind bereits im Feuer gelandet. „Durch das Projekt wird sich nichts ändern“, glaubt Jojo. „Die Leute kommen hierher, um sich zu betrinken.“
Flüchtlingslager mitten in der Stadt
Auch der Faulbrunnenplatz war ein Ort, an den Leute kamen, um sich zu betrinken. Seit die Stadt hier ein Alkoholverbot ausgesprochen hat, muss sich diese Szene andere Zufluchtsorte suchen. Seit ein paar Wochen und noch bis Anfang Mai bietet sich dem Betrachter ein ungewohntes Bild: zwei UN-Flüchtlingszelte, umgeben von einem Lichterkreis. Das Flüchtlingslager wurde errichtet als „Mahnwache für alle ‚offiziellen’ Flüchtlinge, aber auch all jene Menschen, die wegen Ressourcenknappheit, Geistes- und Liebesknappheit in Alkohol und Drogen flüchten.“ Dabei hatte Initiator Hans Reitz, der bereits durch das Überziehen von Ampeln und Pfosten mit Strick Aufmerksamkeit erregte, weniger die Schaffung eines realen Zufluchtsortes im Sinn: „Mir geht es um das provokante Bild, darum, für Themen zu sensibilisieren. Manche können sich gegen das egozentrische Wesen unseres Systems einfach nicht wehren.“
Jeder, der vorbeikommt, ist eingeladen, ein 10 x 10 cm Kunstwerk mit seinen persönlichen Fluchtpunkten zu gestalten. Abends lodert zwischen den Zelten ein Lagerfeuer, die ganze Nacht hindurch kommen Menschen – manche vom Feiern, andere haben kein Zuhause. Aber alle haben etwas zu erzählen. Auch Christian, dessen bayerischer Akzent seine Herkunft verrät, während er zum vorläufigen Ende seiner persönliche Fluchtgeschichte kommt: „Ich bin hier vorbeigelaufen und habe gefragt, ob ich helfen kann. Zeit hab ich schließlich mehr als sonst was.“ Wohin es für ihn geht, wenn die Aktion ihre Zelte abbricht, weiß er noch nicht. „Mein Raucherbein macht mir zu schaffen.“ Die Medikamente, die er deshalb nehmen muss, wird er in Frankreich nicht kriegen, auch das Vorankommen ist schwierig. „Mir bleibt nichts anderes, als hierzubleiben“, resümiert er. Mit den Hilfestellungen der Teestube sucht er eine Wohnung in Wiesbaden. Bislang gestaltet sich das schwierig, aber aufgegeben hat er noch nicht. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja. Vielleicht wird ja Wiesbaden für ihn zu dem einen, letzten Fluchtpunkt, nach dem wir alle suchen: einem Zuhause.
Sensor Veranstaltungs-Tipps: Wiesbaden dreht auf

Ob politischer Diskurs im Theater, FLINTA*-Empowerment auf dem Dancefloor, Indie-Rap…